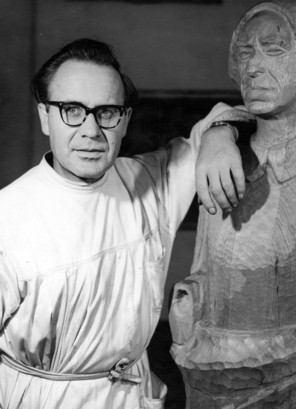Hauptbereich
Museum zur Geschichte von Christen und Juden
Laupheim hat ein Heimatmuseum, aber kein gewöhnliches. Es ist das Museum zur Geschichte von Christen und Juden und handelt vom Zusammenleben der Menschen in Laupheim – drei Jahrhunderte lang gemeinsame Heimat von christlichen und jüdischen Einwohnern. Dieser Gedanke, Mehrheit und Minderheit miteinander ins Verhältnis zu setzen, findet sich nur in diesem Museum im Schloss Großlaupheim. Begonnen hat alles Anfang des 18. Jahrhunderts, als vier jüdische Familien um Aufnahme in Laupheim baten.
Die Ortsherren waren damals die Freiherren von Welden, die auf beiden Schlössern der Stadt residierten. 1730 nahmen sie die Juden unter ihren Schutz und siedelten sie auf dem Judenberg an. Aus diesen Anfängen wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts die größte jüdische Gemeinde Württembergs, mit herausragenden Persönlichkeiten wie Carl Laemmle, Friedrich Adler oder Gretel Bergmann.
Das 1998 eröffnete Museum wurde schrittweise aufgebaut. Die Dauerausstellung in seiner heutigen Form hat das Haus der Geschichte Baden-Württemberg entwickelt.
In den ersten Jahrzehntenwuchs die jüdische Gemeinde in einem rein katholischen Umfeld heran. Im 19. Jahrhundert wurde Laupheim württembergisch und nahm nun auch Protestanten auf. Das fruchtbare Miteinander der Konfessionen ließ die Stadt gedeihen: Herausragendes Beispiel ist die verzweigte Familie Steiner, die weit über Laupheim hinaus Einfluss auf Wirtschaft, Politik und Kultur nahm. Dennoch schwand das Miteinander von Christen und Juden im 20. Jahrhundert und die Koexistenz zerbrach unter der Herrschaft der Nationalsozialisten. 1942 wurde die jüdische Gemeinde zerstört und erst Jahrzehnte nach dem Krieg konnten Schritte der Aussöhnung begangen werden. Mit ihnen entstand auch das Laupheimer Museum.
Neue Dauerausstellung "Jüdische Beziehungsgeschichten"
Im Jahr 2024 feiert die Stadt Laupheim ein ganz besonderes Jubiläum: 300 Jahre jüdisches Leben. Laupheims Geschichte wurde maßgeblich durch das Zusammenleben von christlicher und jüdischer Bevölkerung geprägt. In der neuen Dauerausstellung „Jüdische Beziehungsgeschichten“, welche im Januar 2024 eröffnen wurde, wird dem über Jahrhunderte andauernden Zusammenleben von Christen und Juden in Laupheim nachgespürt. Im Auftrag der Stadt Laupheim hat das Haus der Geschichte Baden-Württemberg die neue Dauerausstellung konzipiert und realisiert, die einen innovativen Ansatz der Vermittlung von jüdischer Geschichte sowie der Erinnerungsarbeit verfolgt. Das einzigartige Konzept erhält aus dem Bundes-Förderprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ 625.000 Euro.
„Jüdische Beziehungsgeschichten“ zeigt auf, wie aus gemeinsamen Interessen und Zielen ein enges Beziehungsgeflecht zwischen Christen und Juden entstand. Judenfeindschaft und Antisemitismus verschwanden dennoch nie ganz und blieben beständige Störfaktoren in dieser gemeinsamen Geschichte. Es sind diese Störfaktoren, die mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus zu einem endgültigen Bruch zwischen Christen und Juden führten. Mit dem Nationalsozialismus war die christlich-jüdische Stadtgesellschaft Laupheims zerstört. Diesem absoluten Tiefpunkt in der gemeinsamen Geschichte widmet sich die Ausstellung genauso, wie dem Umgang damit nach 1945.
Die neue Dauerausstellung bietet den Besuchenden szenografisch ein außergewöhnliches Ausstellungserlebnis: Sie greift die wechselvolle christlich-jüdische Geschichte nicht allein anhand historischer Geschehnisse oder chronologischer Abläufe auf, sondern spannt ein reiches und komplexes Beziehungsgeflecht auf. Am Beispiel prägnanter Ereignisse in der Ortsgeschichte sowie anhand im Beziehungsgeflecht besonders engagierter Laupheimer Persönlichkeiten werden übergreifende Beziehungsgeschichten erzählt. In der Ausstellung spielt vor allem Textil bei der Wissensvermittlung eine große Rolle. Das Material Textil trägt zum Verständnis bei, wie Beziehungen zwischen Menschen entstehen und gelebt werden. Es ermöglicht das Nachvollziehen von Lebenslinien, spannt Hintergründe auf und hilft, Inhalte miteinander zu verknüpft. Es macht sichtbar, wie ein gewachsenes Beziehungsgewebe vollständig zerrissen werden kann. Überdies bietet die neue Dauerausstellung den Besuchenden ungewöhnliche mediale Angebote zum Verständnis der Geschichte.
Gedenk-Buch
Hier können Sie das Gedenk-Buch "Die jüdische Gemeinde Laupheim und ihre Zerstörung" bestellen und die Texte nachlesen.
Museum zur Geschichte von Christen und Juden
Schloss Großlaupheim
Museum zur Geschichte von Christen und Juden
Claus-Graf-Stauffenberg-Str. 15
88471 Laupheim
Telefonnummer: 07392 96800-0
Faxnummer: 07392 96800-18
www.museum-laupheim.de
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag: 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr